Nächste Haltestelle: Barrierefreiheit!
Alles was man wissen muss
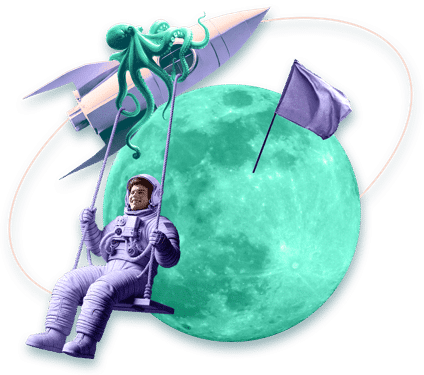
Wo hält mein Bus oder meine S-Bahn und wann muss ich wieder aussteigen? Für die mehr als 550.000 sehbehinderten, 80.000 gehörlosen und 17,1 Millionen schwerhörigen Menschen in Deutschland ist das täglich eine große Herausforderung. Wir von Innovation Natives haben in mehreren Projekten Funktionen einer App entwickelt, die den Zielgruppen eine vereinfachte Nutzung von Bussen und Bahnen ermöglicht. Und so funktioniert`s: Die Zielgruppen werden zum einen mit den Informationen versorgt, die auch den sehenden bzw. hörenden Fahrgäste zur Verfügung stehen. Zum anderen haben wir zusätzliche Assistenzsysteme erarbeitet, mit denen zum Beispiel der richtige Bus einfacher gefunden werden kann.
Der Entwicklungsprozess bestand aus Iterationsschleifen, in denen wir eng mit den Zielgruppen im Austausch standen. Dabei haben wir in explorativen Interviews die Anforderungen an eine barrierefreie Fahrgastkommunikation ermittelt und daraus mögliche Lösungen und Features einer App entwickelt. Die neuen Funktionen haben wir nach dem Lean Development Cycle (Build-measure-Learn) mit den Zielgruppen besprochen, überprüft und weiterentwickelt. Auf diese Weise haben wir uns Schritt für Schritt einer sinnvollen Lösung genähert. Folgende Learnings haben wir aus dem Prozess mitgenommen, die auch für künftige Projekte essenziell sind:
- Dialog statt Schreibtischwissen
Wir müssen bei einem solchen Thema, bei dem wir die Lebensrealität von blinden oder gehörgeschädigten Menschen nicht uneingeschränkt nachvollziehen können, in den intensiven Dialog mit den Zielgruppen gehen und immer wieder Feedback einholen. Andernfalls treffen wir die Annahmen, auf die wir unsere Produkte stützen, immer nur aus der Perspektive von uneingeschränkt sehenden bzw. hörenden Personen. Es lässt sich daher kein Teil unserer Produktentwicklung am Schreibtisch konzipieren. In der Konsequenz bedeutet das: Wir müssen uns in den Kontext begeben, das heißt an die Haltestellen und in die Fahrzeuge, um uns mit den Zielgruppen über ihre Bedürfnisse und Wünsche direkt vor Ort auszutauschen. - Schnelle Fortschritte
Wir müssen mit unseren Projekten schnell einen Nutzen für die Anwender erzielen. Eine rasche Weiterentwicklung ist durch ein schrittweises Vorgehen mit aufeinander aufbauenden Lösungen möglich. So erreichen wir einen hohen Beteiligungsgrad und einen spürbaren Fortschritt für unserer Zielgruppen. Konkret gesprochen: Alle vier Wochen standen wir mit unseren Zielgruppen wieder an den Haltestellen und haben dort neue Lösungen besprochen und überprüft. - Neutraler Vermittler
Wir müssen als Dienstleister die Behindertenverbände und die Verkehrsunternehmen an einen Tisch und sie auf unserer Plattform miteinander ins Gespräch bringen. Wir können als neutrale Instanz häufig einfacher vermitteln, als es im direkten Austausch möglich wäre. Das hilft auch dabei, Verzögerungen vorzubeugen sowie Lösungen konsequent und nachhaltig umzusetzen. - Externe Expertise
Wir müssen die richtigen Leute miteinander vernetzen. Es ist weder realistisch noch wünschenswert, alle Impulse und sämtliche Expertise bei uns zu bündeln, die für eine Produktentwicklung im Bereich des barrierefreien ÖPNV nötig sind. Deshalb identifizieren wir externe Expertise und beziehen sie mit ein. So stehen wir beispielsweise mit Mobilitätstrainer:innen, Gebärdensprachendolmetscher:innen und Barrierefreiheitsexpert:innen in engem Austausch. - Quick Wins
Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Es gibt viele sinnvolle und auch einfache Lösungen, um Barrierefreiheit im ÖPNV zu ermöglichen. Es ist wichtig, genau diese “Quick Wins” zu pflegen und nachhaltig anzubieten. Denn unsere Zielgruppen empfinden es als besonders ärgerlich, wenn Services eingestellt werden mit der Begründung von zu geringem Traffic auf einer App oder Website. Auch wenn die absolute Nutzungszahl solcher Services aus der Perspektive des betreibenden Unternehmens vielleicht niedrig erscheinen mag, machen sie doch für jede:n einzelne:n Betroffene:n einen großen Unterschied. - Passende Features
Wir müssen in der Sprache unserer Zielgruppen kommunizieren. Viele von Geburt an gehörlose Menschen bezeichnen die deutsche Gebärdensprache (DGS) und nicht die deutsche Lautsprache als ihre Muttersprache. Dementsprechend können wir für eine verständlichere Fahrgastkommunikation sorgen, wenn wir die DGS schon bei der Entwicklung mitdenken und für die Vermittlung bestimmter Informationen als Alternative zur Schriftsprache anbieten. Ähnliches gilt für Screenreader (z.B. Voice Over), die von blinden und sehbehinderten Personen auf ihren Smartphones genutzt werden. Wenn wir also neue Features entwickeln, müssen wir uns daher auch immer fragen, inwiefern sich diese auch auditiv, taktil oder in Gebärdensprache umsetzen lassen.
Weites Feld
Im Rahmen der App-Entwicklung haben wir uns intensiv mit den Bedürfnissen von blinden, sehbehinderten, gehörlosen und höreingeschränkten Fahrgästen im ÖPNV beschäftigt. In den Tiefeninterviews sind wir auf viele weitere Bereiche gestoßen, in denen großer Nachholbedarf für sinnvolle Produkte und Services besteht. Es gibt also noch viel zu tun auf dem Weg zur Barrierefreiheit.
Scheitern als Management-Technik? Ein Konzept, das die deutsche Seele vor Herausforderungen stellt
Alles was man wissen muss
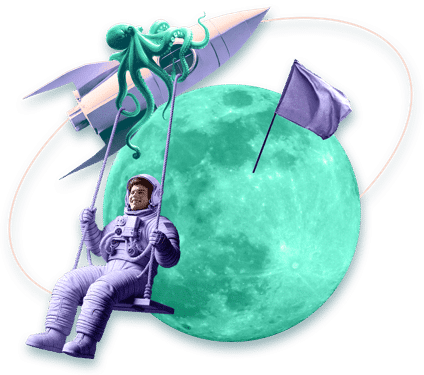
Kinder lernen, indem sie Fehler machen. Sie lernen, indem sie Ausprobieren, Testen, Grenzen überschreiten. Ist die Grenzüberschreitung erfolgreich, werden neue Kompetenzen erworben und Erkenntnisse gewonnen, die sich weiter erproben und verfeinern lassen. Auch Unternehmen müssen dazu lernen. Gerade im unmittelbaren Umfeld einer Basisinnovation ist die Fähigkeit zu Lernen eine überlebenswichtige Qualität. Und das bedeutet: Auch das Management muss eine Einstellung zu “Fehlern” und zum Begriff des “Scheiterns” entwickeln. Der Unterscheid zwischen Kindern und Managern? Kinder machen Fehler, denn sie wissen es nicht besser. Manager müssten es besser wissen. Deshalb bezahlen wir sie dafür, dass sie keine Fehler machen. Klingt logisch – und ist doch von Grund auf falsch. Fehler sind eine notwendige Begleiterscheinung von Risiken. Und das Eingehen von Risiken ist eine notwendige Begleiterscheinung von Unternehmertum. Wer als Unternehmer keine Risiken eingeht, lebt gefährlich.
Dennoch wird im Unternehmenskontext das Lernen aus Fehlern schnell mit Scheitern und Misserfolg gleichgesetzt. Dieses Prinzip durchdringt das Unternehmen auf allen Ebenen: Der Aufsichtsrat kontrolliert den Vorstand im Sinne der Aktionäre und sanktioniert in dieser Funktion Fehler, im ernstesten Fall reagiert er sogar mit der Entlassung des Vorstands. In der Produktion kontrolliert der Schichtleiter die Arbeitsleistung der am Band Beschäftigten. Auch er sanktioniert Fehler mit den dafür vorgesehenen Konsequenzen. Bereits hier wird das Dilemma und die dahinterliegende Frage spürbar: Welche Fehler sind gute Fehler? Welcher Misserfolg ist guter Misserfolg? Wann muss Scheitern sanktioniert und wann belohnt werden? Es scheint, als sei die Bewertung von Verhalten eine Frage des Kontexts und der – gelegentlich strategischen – Argumentation, die einem Scheitern vorausgeht. Kontext und strategisches Argument machen den Unterschied.
In der Theorie klingt das schlüssig und nachvollziehbar. Doch wie sehr uns Deutschen das Vertrauen in das gezielte Lernen aus Fehlern fehlt, zeigt eine bevölkerungsrepräsentative Studie der Universität Hohenheim „Gute Fehler, schlechte Fehler. Obwohl – oder gerade weil – es viele Veranstaltungen und Diskussionsformate gibt, bei denen gescheiterte Gründer von ihren Erfahrungen mit dem Misserfolg erzählen – wie beispielsweise die Fuckup Nights Berlin – ist Deutschland noch weit von einer positiven Kultur des Scheiterns entfernt.
In der Studie wurden 2.000 Teilnehmer im Alter von 18 bis 67 Jahren befragt. Und immerhin lässt sich eine wachsende Zahl zu der Aussage hinreißen, dass sie Fehlschlägen positiv gegenüber stehen und gescheiterte Unternehmen eine zweite Chance verdienen. Das scheint jedoch eher ein ethischer als ein wirtschaftlicher Standpunkt zu sein. Denn auf die Frage, ob sie selbst geschäftliche Beziehungen mit gescheiterten Unternehmen eingehen würden, antworten mehr als 40 Prozent der Befragten, dass sie Vorbehalte gegenüber einem bereits gescheiterten Unternehmen hätten. Eine zweite Chance? Die sollen lieber andere einräumen. Die Studie untersucht, welche Begründungen für Fehlschläge in der deutschen Bevölkerung akzeptiert werden. Am ehesten wird Scheitern akzeptiert, wenn die Gründe dafür außerhalb des eigenen Einflusses liegen – wie die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, ein übermächtiger Wettbewerb oder steigende Preise bei relevanten Produktionsfaktoren. Am wenigsten Verständnis bringen die Befragten Gründern und Unternehmern entgegen, die einfach mal etwas ausprobieren. Das Eingehen willkürlicher Risiken findet in der deutschen Bevölkerung kaum Akzeptanz.
Dass ethische Bedenken bei Fehlern eine Rolle spielen, wird deutlich, wenn man genauer analysiert, was die erfragten Begründungen für Scheitern eigentlich sind: Es sind Entschuldigungen – Begründungen, die eigenes Scheitern entschuldbar machen. Risikobereitschaft, die sich von außen betrachtet nicht als Entrepreneurship sondern als Willkür oder sogar Fahrlässigkeit interpretieren lässt, ist weit entfernt von Bekenntnis und Reue. Sie rechtfertigt keine Vergebung. Keine Vergebung, keine zweite Chance. Das Thema Scheitern lässt sich nicht wirtschaftlich-objektiv betrachten. Es ist überfrachtet mit subjektiven Projektionen, die der eigenen christlich-abendländischen Sozialisierung entstammen. Und das ist ein Problem. Denn dieses Gedankengut sitzt tief. Es ist so tief in uns verwurzelt, dass es uns schwer fällt, dagegen zu argumentieren oder gar zu handeln. Unternehmertum ist als Begriff durchaus positiv besetzt. Risiko nicht. Das das eine das andere braucht, ist ein Dilemma, das sich nur über erfolgreiches Unternehmertum auflösen lässt. Wie kann ein Plädoyer für das Scheitern aussehen, für den Mut zu Scheitern – entgegen aller kulturhistorischen Überzeugungen?
Im Kontext von Innovationen, ist das Scheitern von Ideen und Unternehmungen eine Notwendigkeit: Unternehmen brauchen den Mut, neue Dinge auszuprobieren, zu experimentieren, zu testen, Iterationsstufen zu durchlaufen um letztlich zu einem Mehrwert stiftenden Ergebnis zu gelangen. Ohne Risiko und Scheitern gibt es keinen Fortschritt. Oder anders formuliert: Ohne planvolles Scheitern, wird Fortschritt zur Glücksache – und Glück hat sich bislang ebenso wenig als Management-Technik etabliert. Fehler und Rückschläge sind ein natürlicher Teil von Entwicklungsprozessen. Die anglo-amerikanische Management-Lehre ist der Meinung: Wer keine Fehler macht, hat sich zu wenig zugetraut. Agile Managementmethoden, wie die Lean-Startup-Methode, propagieren das seit Jahren und unermüdlich. Vorträge und Bücher zu diesem Thema erfreuen sich größter Nachfrage. (Lesenswert in diesem Zusammenhang ist auch der Artikel von David J. Bland, der über seine Erfahrungen mit der Lean-Startup-Methode berichtet.) Das zeigt, dass die Bereitschaft besteht, das Thema “Scheitern” neu zu bewerten. Was aber eine notwendige Voraussetzung dafür ist, ist Transparenz und eine nachvollziehbare Vision, die von denen verstanden und geteilt wird, die auch das Risiko teilen. Wer sein Handeln strategisch begründen und sinnvoll aus sich verändernden Umgebungsvariablen ableiten kann, der führt, der unternimmt etwas und darf auch scheitern: Strategisches Argument und Kontext haben die Kraft, das Scheitern ex ante als Erfolgsfall zu codieren. Das gelingt aber nur dann, wenn die Stakeholder des Scheiterns einbezogen werden.
Zurück zum Thema “Lernen”. Es gibt kein Lernen ohne die Bereitschaft, negative Erfahrungen zu machen. Gerade in der heutigen Zeit ist das Management der Lernkurve eines Unternehmens zentrale Führungs- und Entwicklungsaufgabe. Eine steile Lernkurve bedeutet manchmal auch das Eingehen von Risiken, die nicht immer bis in die letzte Konsequenz überschaubar sind.
Dass diese neuzeitlichen Anschauungen kulturell schwer zu verankern sind, mag unter anderem daran liegen, dass ein wesentlicher Teil des deutschen Wohlstandes auf den Unternehmensgründungen im Industriebereich in den 1950er Jahren fußt, die vom durch das Ausland induzierten wirtschaftlichen Aufschwung Deutschlands nach dem zweiten Weltkrieg getragen wurden. Für Gesellschaften mit großem Wohlstand und funktionierender Wirtschaft ist Effizienz schon immer ein hohes Gut und zentraler Bestandteil der Managementpraxis. Dem aber muss man den Satz von Chantell Illbury und Clem Sunter entgegen halten: Success breeds failure. Denn das digitale Zeitalter mit seinen immer kürzeren Entwicklungszyklen und seiner hohen Entwicklungsgeschwindigkeit zwingt Unternehmen zum Umdenken.
Die Entwicklung einer positiven Kultur des Scheiterns braucht ihre Zeit – vor allem in Deutschland. Und dass sich Deutschland auf den Weg gemacht hat, zeigt die Studie ebenfalls: Die jüngeren Befragungsteilnehmer zwischen 18 und 39 Jahren bewerten unternehmerische Fehlschläge bereits weitaus positiver als die ältere Generation. Das gesellschaftliche Umdenken hat bereits begonnen. Und das ist wichtig. Denn nur so wird der Nährboden für Neugründungen und Innovationen fruchtbarer.



